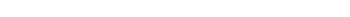Sarika Hahn
Sarika (Charlotte) Hahn, verh. Horvat

Sarika (Charlotte) Hahn, geb. 28.07.1928 in Murska Sobota
Mutter: Irena Kemeny-Hahn, geb. 1902
Vater: Izidor Hahn, geb. 16.03.1893
Sarika Hahn wurde am 28. Juli 1928 in der Kleinstadt Murska Sobota in eine jüdische Familie geboren. Sie war die Tochter von Izidor Hahn und Irena Hahn, geb. Kemeny. Sie wuchs in einer angesehen und gesellschaftlich aktiven Familie auf. Ihr Vater besaß eine Druckerei, eine Buchhandlung und eine Buchbinderei. Zudem war er im gesellschaftlichen und kulturellen Leben in dem Gebiet Prekmurje engagiert. Diese Region in Slowenien war von 1941 bis 1944 unter ungarischer Besatzung. Während dieser Zeit lebten die jüdischen Familien in Prekmurje unter bestimmten Einschränkungen, aber ohne Massenverschleppungen.
Sarika (Charlotte) Hahn – Horvat (1928-2000)
Am 26. April 1944, unmittelbar nach dem Sturz des Horthy-Regimes, begannen die Deportationen der Juden aus Prekmurje nach Auschwitz. Von etwa 500 Juden aus der Region kehrten nur 25 zurück. Zuerst wurden sie aus Murska Sobota in ein Sammellager in Nagykanizsa (Ungarn) gebracht, wo sie einige Wochen blieben. Danach folgte der Transport nach Auschwitz.
Bei der Ankunft in Auschwitz trennte Josef Mengele Sarika von ihrer Mutter und ihrem Bruder Andrej, die sofort in die Gaskammern geschickt wurden. Sarika überlebte sechs Wochen Quarantäne, danach wurde sie zur Zwangsarbeit in Geislingen, bei Stuttgart, ausgewählt, wo sie in einer Waffenfabrik (WMF) arbeitete. Ihre Erinnerungen an diese Zeit wurden 1996 von der Visual History Foundation im Rahmen des Projekts „Survivors oft the Shoah“ aufgezeichnet.
In ihrem Bericht hebt sie hervor, dass sie unter anderem, Dank der Unterstützung einer Aufseherin namens Berta Pommer, überlebte. Diese beschützte Sarika, brachte ihr Medikamente und Essen mit, während sie zu anderen sehr grausam war. Sarika verstand nie, warum gerade sie die Gunst dieser strengen Frau gewann.
Kurz vor Kriegsende wurde sie von Geislingen nach Dachau-Allach verlegt. Ende April 1945 wurde sie zusammen mit anderen Gefangenen wieder auf einen Zug verladen, der in Seeshaupt hielt, wo sie am 30. April von der amerikanischen Armee befreit wurde. Es gibt ein Foto und ein Video von diesem Moment, auf dem Sarika (in der Mitte) mit einer anderen Überlebenden vor einem Waggon voller Leichen steht, zusammen mit Pfc. Andrew. E. Dubill. Diese gehören heute zur Sammlung des Yad Vashem Museums in Jerusalem sowie des USHM in Washington und wurden auch im Museum für Fotografie in Berlin gezeigt (Foto: Al Gretz, 1.5.1945)

Ihr Vater Izidor kehrte nicht aus dem Lager zurück. Dokumente aus dem Auschwitz-Archiv und ein tschechischer Polizeibericht von 1945 zeigen, dass er auf einem sogenannten „Todesmarsch“ starb in in Budweis (Ceska Budejovice) begraben ist.
Nach dem Krieg kehrte Sarika in das Elternhaus zurück, das ausgeplündert war und später verstaatlicht wurde. Sie lebte bescheiden, wurde Hausfrau, heiratete 1948 Stefan Horvat und gründete eine Familie mit einem Sohn Andrej und einer Tochter Irena. Sie lebte bis zu ihrem Tod 2000 in Murska Sobota und hinterließ vier Enkelkinder.
Obwohl sie kaum über ihre Lagerzeit sprach, sind ihre wenigen Aufzeichnungen und Zeugnisse eine wertvolle Quelle zum Schicksal der Juden aus Prekmurje und deren Marginalisierung (Verdrängung an den Rand der Gesellschaft) nach dem Krieg. Ihre Lebensgeschichte ist ein bedeutendes Zeugnis des Holocaust und davon, wie man im Stillen und mit unterdrücktem Schmerz weiterlebt.
Zitat aus ihrem Lebenszeugnis:
„Es war schwer, es war furchtbar. Ein Mensch hält mehr aus als ein Tier. Als ich im kleinen Lager in Deutschland ankam, ging es mir besser. Wir mussten in der Fabrik arbeiten. Im Winter hatten wir keine Socken, nur Holzschuhe, und gestreifte Kleidung. Es war furchtbar kalt. Aber in der Kantine der Fabrik konnten wir essen. Wir bekamen ihr Essen, das war für ein Lager ziemlich gut. Dort in der Fabrik waren SS-Aufseherinnen. Eine sah, dass ich nicht arbeiten konnte- ich musste etwas feilen. Es ging mir sehr schlecht und sie zeigte mir, ich solle zu ihr kommen. Sie gab mir eine neue Aufgabe. Ich musste Essen austeilen und die Toiletten reinigen. Und diese Frau, diese SS-Aufseherin, mochte mich. Stellen Sie sich das vor. Sie war sonst grausam, furchtbar, die Schlimmste. Aber wenn sie mich sah, änderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie brachte mir immer etwas zum Essen und Medizin. Eine der Gefangenen war älter als ich und wollte Selbstmord begehen. Sie warf sich an den elektrischen Zaun. Unsere Frauen retteten sie. Die Männer litten mehr als die Frauen. Sie brauchten mehr Essen und mussten härter arbeiten.
Das war Geislingen, bei Stuttgart, eine kleine Stadt. Wir waren nicht viele im Lager, es gab nicht viele Baracken. Wir arbeiteten in zwei Schichten, tagsüber und nachts. Ich glaube, es war ein kleines Lager. Einmal traf ich jemanden aus Geislingen am Meer in Kroatien und fragte, ob das Lager noch steht. Er antwortete mir schroff, er wisse nichts von einem Lager oder einer Fabrik dort. Es war eine große Fabrik, die für die Herstellung von Munition umgebaut wurde. Ich habe nur Munition gemacht.
Ich war mit einer Frau aus der Slowakei im Zimmer. Sie war anders als ich, eine orthodoxe Jüdin. Ich habe solche Bräuche dort zum ersten Mal gesehen, weil wir zu Hause nicht gläubig waren. Wir waren uns sehr nah. Sie war auch ohne Mutter. Ich erinnere mich nicht, wie es ihr mit ihrer Mutter ging. Vielleicht hat sie es mir erzählt. Wir bekamen viel Broma ins Essen, so eine Art Beruhigungsmittel, damit wir nicht so empfindlich waren. Wir hatten keine monatliche Regel, deshalb mussten sie uns etwas geben. Einige Ältere sagten, das sein der Grund, warum wir so gleichgültig waren. Mit den anderen Frauen sprachen wir nur übers Essen. Wir kochten ständig im Kopf, weil wir hungrig waren.
Ich suchte niemanden, der meine Mutter ersetzt. Nur eine ältere Frau aus Murska Sobota arbeitete im Büro, weil sie gut Deutsch konnte. Ich sagte der SS-Aufseherin, das sei meine Cousine. Sie ging mehrmals mit mir ins Büro, damit ich sie besuchen konnte.
Diese Frau, die SS-Aufseherin, half mir. Sie brachte mich sogar zu sich nach Hause und kochte für mich. Sie wohnte nicht alleine, hatte einen Mann, der auch in der Fabrik arbeitete. Sie war sehr vulgär, von ihr habe ich Fluchen gelernt. Man nannte sie „Bromml“, ich weiß ihren richtigen Namen nicht. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Es ist mir bis heute unverständlich, warum sie sich so um mich kümmerte. Sie hatte ältere Kinder und war ziemlich alt. Bevor wir weiter nach Dachau gebracht wurden, kam sie, um sich von mir zu verabschieden. Vielleicht tat ich ihr leid. Zu anderen war sie grausam. Sie schrie sie an, schlug sie und hatte eine Peitsche. Deshalb verstehe ich nicht, warum sie mir half.
Dann gingen wir nach Allach. Dort war es furchtbar. Wir dachten, sie würden uns alle töten. Dort mussten wir nicht arbeiten. Wir hatten kein Essen und aßen Brennnesseln. Dann wurden wir wieder in Waggons gepfercht, ein schrecklich langer Zug, und fuhren mehrere Tage. Dann befreiten uns die Amerikaner. Ich stieg nicht aus dem Waggon, die Angst war zu groß. Ich hatte eine tschechische Freundin, an die hielt ich mich.“
Verfasst von ihrer Enkeltochter Sasa Savel-Burkart